Die Wiedervereinigung Süderjütlands mit Dänemark, zu der es im Jahre 1920 kam, war das Ergebnis einer Volksabstimmung, die man im damaligen Schleswig durchführte. Doch bevor man sich auf das Wie der Durchführung einigen konnte, gab es unter den beteiligten Parteien eine hitzige Debatte über dieses Thema. Es ging vor allem darum, wer die Abstimmung überwachen und dafür verantwortlich sein sollte, wer im Rahmen der Volksabstimmung stimmberechtigt sein sollte und wie man das Abstimmungsgebiet einteilen sollte. Eine internationale Kommission sprach schließlich das Urteil in dieser Diskussion und legte unter anderem fest, dass das Abstimmungsgebiet in Zonen eingeteilt werden würde, wobei die Grenze zwischen der so genannten 1. und der 2. Zone dem heutigen Grenzverlauf entsprach. Diese Grenze zwischen den beiden Zonen ist im Vorfeld massiv umstritten gewesen. Auf die Abstimmung des Jahres 1920 folgten übrigens noch eine ganze Reihe international überwachter Volksabstimmungen, die Grenzverläufe veränderten: Allenstein und Marienwerder im Juli 1920, Kärnten im Oktober 1920, Oberschlesien im März 1921, das Burgenland im Dezember 1921 und die Saar im Januar 1935.
Wahlverfahren
In einer idealen Welt würde jede Wahl zwei Grundsätze erfüllen: Sie wäre frei und sie wäre gerecht. Jeder erwachsene Bürger hätte frei die Möglichkeit, eine Partei oder einen Kandidaten zu wählen, und jede einzelne Stimme hätte das gleiche Gewicht. Eine freie Wahl zu gewährleisten, ist die Aufgabe der Gesetzgebung und damit ein juristisches Problem. Aber was ist mit der Gewährleistung einer gerechten Wahl? Gegen Ende des 18. Jahrhunderts, während der französischen Revolution, haben sich die Mathematiker systematisch mit Wahlen und dem Einfluss des Wahlverfahrens auf den Ausgang einer Wahl beschäftigt. Dabei stießen sie auf zahlreiche Paradoxe und Überraschungen. Schon im Jahre 1785 bemerkte der französische Mathematiker Marquis de Condorect (1743-1794) ein Paradox in Wahlverfahren, die darauf beruhen, dass die Wähler bestimmten Kandidaten den Vorzug geben, woraufhin der Kandidat mit dem niedrigsten Ergebnis ausscheidet. Daraufhin wird das Verfahren wiederholt, bis einer der Kandidaten von mehr als der Hälfte der Wähler gewählt wird. Dieses Verfahren kommt unter anderem bei der Wahl des australischen Repräsentantenhauses, in mehreren Städten der USA und bei der Präsidentenwahl in Irland und Indien zum Einsatz. Der Marquis de Condorect stellte nun Folgendes fest: Wenn wir beispielsweise die drei Kandidaten A, B und C und drei Wähler haben, deren Wahl „A-B-C“, „B-C-A“ und „C-A-B“ lautet, gewinnt A vor B mit 2:1. Aber es gewinnen auch B vor C mit 2:1 und C vor A mit 2:1. Selbst wenn dieses Verfahren also sehr gerecht zu sein scheint, ist es nicht frei von Paradoxen.
In den USA, Großbritannien und anderen Ländern arbeitet man mit dem so genannten Mehrheitswahlrecht, bei dem das Wahlgebiet in Einmannwahlkreise aufgegliedert wird, in denen nur eine einfache Mehrheit erforderlich ist, um gewählt zu werden. Dieses Verfahren hat zwei große Vorteile. Zunächst einmal kommt man so zu einem eindeutigen Ergebnis und erreicht oftmals eine Mehrheitsregierung. Zum anderen wird eine klare Verbindung zwischen den Wählern und dem von ihnen gewählten Vertreter geschaffen. Aber ein ganz einfaches Beispiel kann uns zeigen, welche Mängel auch in diesem Verfahren stecken. Stell dir einmal vor, dass wir drei Wahlkreise haben, in denen einmal 10.000, einmal 3 und einmal 5 Wähler leben. Außerdem haben wir die beiden Parteien A und B. Im ersten Wahlkreis stimmen alle für A. In den anderen beiden Wahlkreisen stimmen alle für B. Somit erhält Partei A einen Platz und 10.000 Stimmen, während B zwei Plätze und 8 Stimmen bekommt. Partei B gewinnt die Wahl, obwohl sie erheblich weniger Stimmen auf sich vereinen konnte als Partei A. Dieses Problem tritt auch in der Praxis auf. Bei der Wahl des amerikanischen Präsidenten bekamen Donald Trump und die Republikaner 304 Wählerstimmen und 46,1 % aller Stimmen, während Hillary Clinton und die Demokraten 227 Wählerstimmen und 48,2 % der Stimmen hatten. Auf dieser Grundlage hat Donald Trump die Wahl gewonnen.
Das gerechteste Wahlverfahren besteht sicherlich darin, den aufgestellten Kandidaten oder Parteien ihre Plätze auf der Grundlage ihrer erreichten Stimmenanzahl zuzuweisen, was man als Proporz oder Verhältniswahlrecht bezeichnet. Aber auch dieses Verfahren ist nicht frei von Paradoxen. Denn die Anzahl der Plätze in einem Parlament oder einer ähnlichen Einrichtung kann ja nur eine ganze Zahl sein, während der einzelne Kandidat oder die einzelne Partei üblicherweise einen prozentualen Anteil der Stimmen bekommt, der in einer Dezimalzahl ausgedrückt wird. Wenn beispielsweise zehn Mandate zur Wahl stehen und drei Parteien jeweils ein Drittel der Stimmen erhalten, bestünde die bestmögliche Umsetzung dieses Ergebnisses darin, zweimal drei und einmal vier Plätze zu vergeben. Aber warum sollte die eine Partei mehr Plätze bekommen als die anderen? Ein anderes Problem ist, dass manche Parteien oder Länder überhaupt keine Plätze bekommen. So muss eine Partei in Dänemark normalerweise mindestens 2 % der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen, damit ihr ein Mandat im Parlament zugestanden wird. In Deutschland müssen Parteien sogar 5 % der abgegebenen Stimmen erreichen, um in den Bundestag einzuziehen. Bei einer Wahl zum Europaparlament kann das Verhältniswahlrecht dazu führen, dass ein Land ganz ohne Vertreter bleibt. Um dieses Problem zu beheben, hat jedes Land eine feste Anzahl an Plätzen im Parlament, die im Idealfall rein der Proportionalität entsprechend vergeben werden.
Es gibt eine ganze Reihe von Verfahren, um die Probleme zu lösen, die uns das Verhältniswahlrecht aufgibt. Die gebräuchlichsten sind das D’Hondt-Verfahren, das nach dem belgischen Juristen Victor D’Hondt (1801-1901) benannt ist, und das Webster/Sainte-Laguë-Verfahren, das seinen Namen dem amerikanischen Senator Daniel Webster (1782-1852) und dem französischen Mathematiker André Sainte-Laguë (1882-1950) verdankt. Bei beiden Verfahren werden die Stimmen aller Parteien durch eine Reihe von Divisoren geteilt, sodass eine Reihe von Quotienten dabei herauskommt. Die Partei, die den höchsten der errechneten Quotienten hat, erhält das erste Mandat. Der zweithöchste Quotient berechtigt zum zweiten Mandat, und so weiter, bis alle Mandate vergeben sind. Der Unterschied zwischen den beiden Verfahren ist nur der, dass sie mit unterschiedlichen Divisoren arbeiten. Beim D’Hondt-Verfahren wird durch 1, 2, 3, 4, 5, usw. geteilt, während beim Webster/Sainte-Laguë-Verfahren durch 1, 3, 5, 7, 9, usw. geteilt wird. Das D’Hondt-Verfahren bevorteilt große Parteien, während das Webster/Sainte-Laguë-Verfahren das Risiko birgt, dass eine Partei, die mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen hat, am Ende weniger als die Hälfte aller vergebenen Mandate erhält.
Wahl in Dänemark und Deutschland
In Dänemark werden bei der Parlamentswahl 179 Parlamentsmitglieder gewählt – 175 in Dänemark, zwei auf Grönland und zwei auf den Färöern. Die 175 in Dänemark gewählten Mitglieder setzen sich aus 135 so genannten Kreismandaten und 40 so genannten Ausgleichsmandaten zusammen. Die Kreismandate werden mit Hilfe des D’Hondt-Verfahrens vergeben. Wenn die Verteilung der Kreismandate abgeschlossen ist, wird auf Landesebene errechnet, zu wie vielen Mandaten die Parteien berechtigt sind. Diese Berechnung ist die Basis für die Verteilung der 40 Ausgleichsmandate, die mit Hilfe des Webster/Sainte-Laguë-Verfahrens zugewiesen werden. So kommt das dänische Wahlsystem sehr nah an eine „echte“ Verhältniswahl heran. In Deutschland kommt bei der Bundestagswahl und bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein das Webster/Sainte-Laguë-Verfahren zum Einsatz. Hier hat der Wähler zwei Stimmen – eine für einen Kandidaten und eine für eine Partei. Die eine Stimme wird also als persönliche Stimme direkt für einen der Kandidaten abgegeben, die in dem Einmannwahlkreis aufgestellt sind, in dem der betreffende Wähler wohnt. Diese Stimme ist entscheidend dafür, welche Kandidaten/Parteien Kreismandate erhalten. Die andere Stimme wird als Parteistimme einer Partei gegeben, die in dem Bundesland aufgestellt ist, in dem der betreffende Wähler wohnt. Somit ist das deutsche Wahlsystem eine Mischung aus dem britischen, das direkte Wahlen in Einmannwahlkreisen vorsieht, und dem Verhältniswahlrecht in Dänemark.
Allgemeines Unmöglichkeitstheorem nach Arrow
Auch wenn sich viele Mathematiker mit Wahlverfahren beschäftigt haben, hat man sich dem Thema erst nach dem 2. Weltkrieg von einem theoretischeren Ansatz aus genähert. Insbesondere der amerikanische Ökonom Kenneth Arrow (1921-2017) hat sehr dazu beigetragen, eine Mathematik der Wahlverfahren zu entwickeln. Arrow hat bereits im Jahre 1951 versucht, ein Wahlverfahren zu finden, das nach vernünftigen und angemessenen Kriterien als „gerecht“ bezeichnet werden kann. Das erwies sich als schwierige Aufgabe. Arrow musste einsehen, dass er machen konnte, was er wollte – er konnte kein Verfahren finden, das die Kriterien erfüllt hätte. 1963 formulierte er sein Unmöglichkeitstheorem, das ein wichtiges Ergebnis der Sozialwahltheorie darstellt. Letztendlich geht es um Folgendes: Wenn die Wähler zwischen mindestens drei verschiedenen Möglichkeiten wählen können, gibt es kein Wahlverfahren, das eine logische Durchführung gewährleisten und gleichzeitig bestimmte vernünftige Kriterien erfüllen kann. Arrows Unmöglichkeitstheorem wird als das wichtigste Ergebnis der Wahlverfahrensforschung betrachtet und hat Ökonomen, Soziologen und Mathematiker dazu angeregt, verschiedene Theorien zum Thema „Wahlen“ zu betrachten und zu entwickeln. Außerdem hat das Unmöglichkeitstheorem dazu beigetragen, dass Kenneth Arrow im Jahre 1972 den Wirtschaftsnobelpreis bekam.
Wenn du mehr über die Mathematik von Wahlen wissen möchtest, kannst du diesen Link anklicken. Er führt zu den so genannten Gresham College-Vorlesungen von Chris Budds, einem Professor für angewandte Mathematik an der Universität von Bath (England):
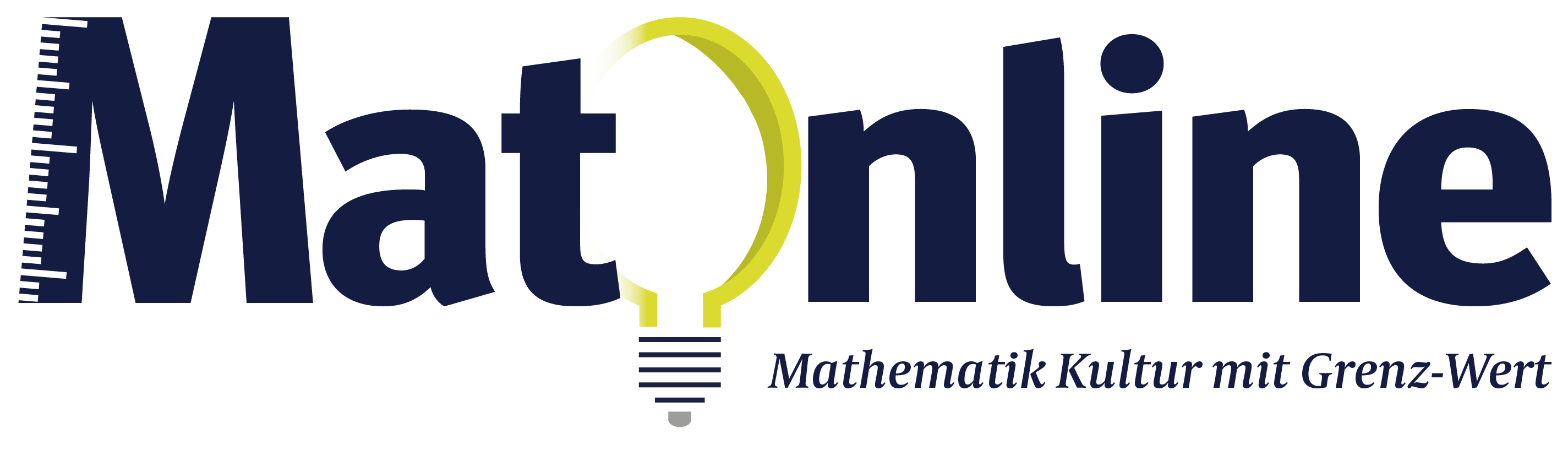

Gib den ersten Kommentar ab